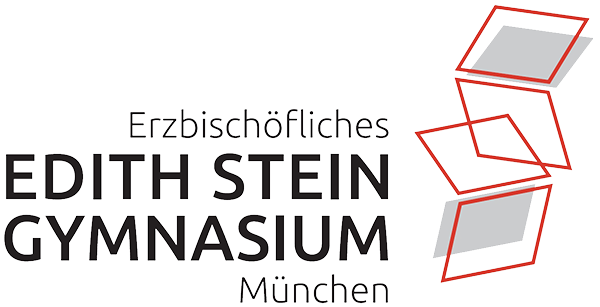Klösterliche Mädchenbildung auf dem Gebiet der heutigen Erzdiözese München und Freising, ein Vortrag am ESG von Dr. Bettina Blessing, die Geschichte und Kultur im Auftrag der Erzdiözese in Zusammenarbeit mit dem Verein für Diözesangeschichte erforscht hat.
Die Bildung von Mädchen war über Jahrhunderte hinweg untrennbar mit den Frauenorden verbunden. Ein aktuelles Kooperationsprojekt des Vereins für Diözesangeschichte unter dem Vorsitz von Franz Xaver Bischof beleuchtet nun umfassend die Entwicklung der Mädchenorden in München, ihre Bedeutung für die Bildungslandschaft und die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Tradition und staatlicher Reform.
Klöster als Bildungsstätten
Bereits im Mittelalter begannen sich Orden in Europa zu gründen, auch auf dem Gebiet der heutigen Erzdiözese München und Freising. Frauenklöster waren nicht nur religiöse Orte, sondern entwickelten sich zu wichtigen Zentren der Mädchenbildung. Besonders die klösterlichen Lehrgemeinschaften leisteten einen bedeutenden Beitrag zur Bildung junger Frauen – in einer Zeit, in der es keine staatlichen Bildungsangebote für Mädchen gab.
Doch die Lehrinhalte unterlagen keiner externen Kontrolle. Erst mit den Reformen unter Minister Karl Theodor von Dalberg und später unter Maximilian von Montgelas sowie Minister Franz Xaver von Braun im 18. Jahrhundert begann der Staat, Einfluss auf die Erziehung zu nehmen. Es wurden Lehrbücher kontrolliert und Prüfungen eingeführt – ein großer Einschnitt in das bisher autark geführte Bildungssystem der Klöster.
Vom Kloster zur Schule – Brüche und Neuanfänge
Mit der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts wurden viele Klöster aufgehoben, ihre Mittel sollten in den Aufbau staatlicher Mädchenbildung fließen. Die verbliebenen klösterlichen Schulen, wie etwa die der Englischen Fräulein ab 1790, unterlagen zunehmend strengen Vorschriften. Klöster mussten nun Elementarschulen führen – oft unter Auflagen, da sie nur bestehen sollten, bis es genügend weltliche Lehrerinnen gäbe. Die Schulkommission überprüfte Lehrpersonal und Unterrichtsinhalte. Die Kritik an den klösterlichen Schulen wuchs. Ordensschwestern galten als nicht mehr zeitgemäß, ihre Lehrmethoden seien überholt, der Unterricht zu sehr von Ordensnormen geprägt. Die Vorbereitung auf die Mutterrolle war oft der einzige gesellschaftlich akzeptierte Zweck der Bildung. Trotzdem blieb die klösterliche Bildung für viele Mädchen – insbesondere auf dem Land – lange Zeit die einzige Zugangsmöglichkeit zu strukturiertem Unterricht.
Wandel im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert stieg die Zahl weltlicher Lehrerinnen, die zunehmend mit den Ordensschwestern in Konkurrenz traten. Die katholische Kirche versuchte dem mit der Stärkung des Frauenbildes und der Gründung neuer klösterlicher Gemeinschaften entgegenzuwirken. Ziel war es, ein bürgerliches Familienideal zu vermitteln und durch klösterliche Bildung häusliche Geborgenheit zu schaffen.
Während der Kulturkampf unter Bismarck hemmend auf die Entwicklung der Klosterschulen wirkte, entstanden dennoch neue Frauenorden – allerdings ohne schulische Einrichtungen. Die klösterliche Lehrtätigkeit nahm ab, der Ruf der Ordensschwestern als Erzieherinnen war beschädigt, die Gemeinschaften zerfielen vielerorts. Dennoch blieb das Bedürfnis nach weiblicher Bildung bestehen – und mit ihm der Versuch, klösterliche Werte in eine moderne Bildungswelt zu übersetzen.
Heute und morgen – Die Zukunft der Mädchenbildung
Die Veranstaltung schloss mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Franz Xaver Bischof betonte die Bedeutung historischer Aufarbeitung für die Gegenwart und wies auf kommende Veranstaltungen hin. Die Freude über das gewachsene Interesse an der Geschichte der Mädchenbildung war spürbar – ebenso wie der Wunsch, den Beitrag der Frauenorden nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Forschung, Einblicke, Perspektiven
Bei der jüngsten Veranstaltung des Vereins für Diözesangeschichte wurde ein Blick zurück und nach vorn geworfen. Frau Dr. Bettina Blessing, deren früherer Forschungsschwerpunkt im Bereich Medizingeschichte, Krankenpflege und dem Sozialprofil klösterlicher Gemeinschaft lag, präsentierte zentrale Ergebnisse ihrer Studien zur Rolle der Frauenorden in der Mädchenbildung.
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Übergabe der Gesamtsichtung des Archivmaterials an Frau Dr. Sandra Krump, Leiterin des Ressorts Bildung im erzbischöflichen Ordinariat. Hier eröffnen sich neue Forschungsmöglichkeiten, denn trotz der reichen Geschichte wurde das Thema „Mädchenorden“ bislang nur wenig untersucht.
Auch wenn heute staatliche und weltliche Bildungsangebote dominieren, bleibt das historische Erbe der Frauenorden in München lebendig. Es mahnt nicht nur zur Erinnerung, sondern auch dazu, die Zukunft der Mädchenbildung mit Verantwortung und Weitblick zu gestalten. Eine Aufgabe, der sich das ESG annimmt und den Rahmen bietet.